Vulkanismus im Siebengebirge
Das
Siebengebirge liegt am rechten Rheinufer, ungefähr
südostlich
von Bonn. Im Gebiet gibt es über fünfzig Berge und
Hügel. Der höchste ist der etwa 460 Meter hohe
Őlberg. Diese
Berge und Hügel danken ihr Dasein dem Vulkanismus, den es hier
während des Tertiärs gab. Dieser Vulkanismus fand zum
größten Teil während des
Obenoligozäns statt, vor
etwa 28 bis 22 Millionen Jahren.
Der jüngste Vulkanismus im Siebengebirge trat aber
während
des Miozäns auf, vor weniger als 15 Millionen Jahren. Diesen
Vulkanismus im Siebengebirge danken wir den Intraplattenvulkanen.
Hierbei stieg eine heiße Mantelplume bis an die Basis der
Erdkruste auf. Diese verursachte ein zunehmendes Aufschmelzen der
Gesteine im oberen Erdmantel, wodurch Hotspot-Magmen entstanden und mit
diesen Magmen konnten die vulkanischen Aktivitäten an der
Oberfläche ausgelöst werden.
Zuerst
war der Vulkanismus im Gebiet explosiv von Art. Während der
sogenannten plinianischen und phreatomagmatischen Eruptionen entstand
ein dickes Paket aus vulkanischen Aschen und
Gesteinsbruchstücken,
die ausgeworfen wurden. Dieses Paket kann zunächst einige
hundert
Meter dick gewesen sein, und verfestigte sich zu Tuff.
Später entstand wieder Vulkanismus. Magma drang in die Tuffsteindecke durch. Dieses Magma erreichte meistens nicht die Oberfläche, sondern kühlte langsam in der Tuffdecke ab und bildete dort Gesteinskuppen und Gesteinsgänge aus Basalt, Trachyt und Latit, die härter waren als die umgebenden Tuffsteine. Ein wichtiger Teil des Tuffsteinpakets ist durch spätere Verwitterung und Erosion verschwunden. Die härteren, mehr verwitterungsresistenten Gesteinskuppen und Gesteinsgänge blieben dabei als Erhebungen an der Oberfläche zurück. Sie sind verantwortlich für die Entstehung der Berge und Hügel im Siebengebirge.
 |
||
| Zuerst entstand ein mächtiges Paket aus vulkanischen Aschen, die sich zu Tuff (niederländisch: tufsteen) verfestigten. | Später drang Magma in die Tuffsteindecke durch und bildete harte vulkanische Gesteine. | Durch Verwitterung blieben diese harten Gesteinskuppen als Berge und Hügel an der Oberfläche zurück. |
| Mit gefärbtem Papier und ein wenig Sand kann man einfach die Entstehung des Siebengebirges verdeutlichen. | ||
In
der Vergangenheit wurden die vulkanischen Gesteine aus dem
Siebengebirge als Baustein verwendet. Bereits zur Römerzeit
gab es
Steinbrüche im Gebiet. Wir können durch diese
Steinbrüche heutzutage in das Innerste dieses vulkanischen
Gebiets
hineinschauen. Die meisten Steinbrüche sind verlassen und das
Siebengebirge wurde 1900 zum Naturschutzgebiet erklärt. Im
Folgenden werden wir einige der Berge im Siebengebirge etwas
näher
betrachten.

Steinbruch
mit Basaltsäulen im Őlberg
Basaltsäule
in einem überfluteten Teil des Steinbruchs
Neben
dem Wanderweg zum Restaurant auf dem Gipfel

Mächtige
Trachytsäule am Nasseplatz
Grenze zwischen Trachyt
(dunkel)
und Tuffstein (hell)

Trachyt:
hell nicht verwittert, dunkel etwas verwittert
Tuffstein
Eine
Besonderheit des Weilbergs ist die sogenannte Tulpe. Nachdem der
Basaltgang entstanden war, drang erneut vulkanische Schmelze auf. Der
Basaltgang wurde dabei durchbrochen und die Schmelze drang weiter im
Tuffstein auf. Eine typische Tulpenstruktur entstand. Der Tuffstein
kann man sich ganz nahe ansehen beim Aussichtspunkt.

Die
gelben Linien zeigen den Umriß der Tulpe.
Die
Tulpe
(gelber Pfeil) und das Tuffsteinpaket mit dem roten Tuffstein (rote
Pfeile)
Die
Kuppe mit Basaltsäulen

Der
Tuffstein beim Aussichtspunkt am Weilberg
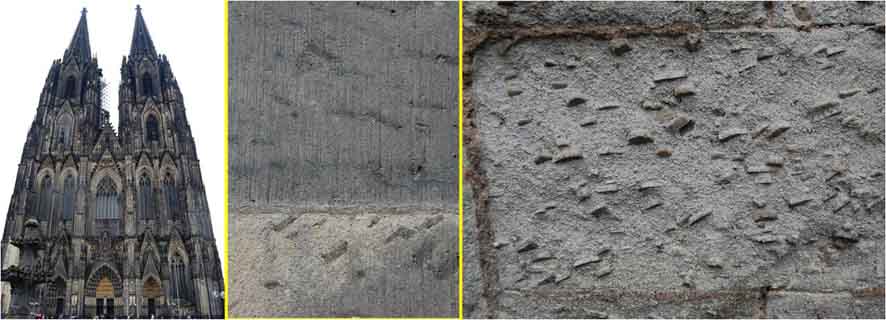 |
||
| Der Kölner Dom | Trachyt des Drachenfels mit Sanidinkristallen im Kölner Dom | Durch Verwitterung auspräparierte Sanidinkristalle im Trachyt des Drachenfels der Kirche Groß St. Martin in Köln |
 |
||
| Trachyt des Drachenfels im Sandrasteeg in Deventer | Hohlräume deuten die Stelle an, wo sich die Sanidinkristalle befunden haben. | Sanidinkristalle (gelbe Pfeile) im Trachyt des Drachenfels im Sandrasteeg |
Durch den intensiven Abbau stürzte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Teil der Burgruine des Drachenfels ein. Der Abbau wurde eingestellt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Steinbruchwände mit Ankern gesichert, um weiteres Abstürzen vorzubeugen. Heute kann man mit einer Zahnradbahn zum Gipfel des Drachenfels. Dort hat man eine schöne Aussicht über das Siebengebirge und den Rheintal.
 |
||
| Mit der Zahnradbahn zum Gipfel des Drachenfels | Aussicht über das Siebengebirge vom Gipfel des Drachenfels | Die Burgruine auf dem Drachenfels |
Text: Jan Weertz
Fotos: Jan und Els Weertz
